|

1996 wird das 1.
Mai-Fest auf der Kasernenwiese u.a. mit "Tränengas"
abgeduscht
Zitat Polizei: «Richtig,
es ist auch nie in das Areal reingeschossen worden.»
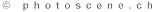
| 5.
Schadwirkungen auf die Haut |
 |
Hautsymptome nach
Tränengasexposition sind häufig und seit langem bekannt (19/26/27).
Bei der Durchsicht der Literatur finden sich eine Anzahl von Fallbeschreibungen,
wo kurz nach, beziehungsweise auch noch während der Tränengaswirkung
unangenehme Sensationen wie Brennen, Stechen und Juckreiz sowie auch sichtbare
Hautveränderungen auftraten. Daneben werden aber auch Fälle
beschrieben, bei denen erst wiederholte Tränengasexposition zu Hauterscheinungen
im Sinne einer Entzündung (Kontaktdermatitis) führten.

|
Zürich:
Verbrennungen

durch
"Wasser"werfer
|
|
|
|
Erneut
"Tränengas"-Schwerverletzte 1.2.02
>>> Dank der erpobten
Komplizenschaft zwischen Polizei und
Universitätsspital erblicken die wenigsten Personenschäden
das Licht
der Öffentlichkeit. Obwohl die ÄrztInnen noch extra angewiesen worden
waren, auch Patienten gegenüber strengstes Stillschweigen zu bewahren,
deckt PigBrother nunmehr zwei weitere Fälle auf - mit
erschütternden
Bildern, die für sich selbst sprechen ...
Direktlink
|
 |
1941 schildern Queen und Stander (25) einen Fall mit
ausgeprägter Hautsymptomatik nach Kontakt mit Tränengas und
interpretieren diese im Sinne einer Ueberempfindlichkeitsreaktion auf
CN ("idiopathic hypersensitivity").
Im Rahmen einer routinemässig durchgeführten Uebung zur Handhabung
von Kampfgasen (in diesem Fall CN, die Konzentration betrug 1/10 des unter
Einsatzbedingungen zu erwartenden Wertes, die Expositionsdauer betrug
5 Minuten und es wurden Gasmasken getragen) kam es bei einem der Beteiligten
wenige Minuten nach Verlassen des Giftmilieus zu einer akuten Symptomatik.
Der Betroffene klagte zunächst über zunehmend quälenden,
generalisierten Juckreiz, später traten noch Fieber und ein allgemeines
Krankheitsgefühl hinzu. 4 1/2 Stunden nach Exposition war die ganze
Haut diffus gerötet, infiltriert und oedematoes (geschwollen) verändert.
Schliesslich wurde auch eine Blasenbildung beobachtet. Diese akuten Symptome
verschwanden nach 4 Tagen, aber eine nach einer Woche auftretende Schuppung
verschwand erst nach 4 Wochen. Die Krankengeschichte ergab dann, dass
dieser Betroffene bereits 17 Jahre zuvor einmal mit CN in Kontakt gekommen
war. Damals trat jedoch nur ein schwacher Juckreiz auf. 1942 wurde der
Fall eines Soldaten beschrieben (22), der 6 Stunden
nach einem Aufenthalt in einem Raum mit "relativ" hoher Konzentration
von CN folgende Hautsymptome zeigte: Reizung, Auftreten eines masernähnlichen
Hautausschlages, z.T. mit Blasenbildung, später eine diffuse Rötung
und oedematose Veränderung. Mit einer lokalen Therapie verschwanden
diese Symptome nach 2 Wochen. In der Folge trug der Soldat wiederholt
einen Helm, der nach dem Erstkontakt mit CN nicht gereinigt wurde. Dieser
Helm verursachte an der Kopfhaut ekzemähnliche Hautveränderungen.
Kissen & Mazer (23) schildern einen Fall, bei dem
es nach der 2. Tränengasexposition zu geringgradigen, auf bestimmte
Hautareale beschränkte entzündliche Hautveränderungen,
nach der 3. Exposition aber zum Auftreten einer schweren, generalisierten
Hautentzündung kam. Ein von Madden und Paul 1951 (34)
beobachteter Fall, reagierte ebenfalls auf wiederholten Kontakt mit Tränengas,
jedesmal mit immer ausgeprägteren bis zu einigen Wochen andauernden
ekzematoiden Hautveränderungen. In beiden Fällen ergaben Hauttests
mit der verdächtigen Substanz (Tränengas) stark positive Reaktionen.
Auch Symptome an der Haut nach Einsatz der chemischen Keule wurden beschrieben
(20).
Eine eindeutige Interpretation der hier kurz angeführten Hautreaktionen
nach wiederholtem Kontakt mit Tränengas im Sinne einer toxischen
oder allergischen Reaktion ist auf Grund der z.T. unklar beschriebenen
Symptomatik und auch des Fehlens von dafür nötigen Testergebnissen
nicht gut möglich. Den meisten Darstellungen fehlen genaue Angaben
über Konzentrationen und Expositionszeiten. Trotzdem wird von den
Autoren festgehalten, dass die durch Tränengas hervorgerufenen Hauterscheinungen
über das hinausgehen können, was mit einem Einsatz erzielt werden
möchte.
Neben diesen Fallbeschreibungen finden sich in der Literatur auch experimentelle
Arbeiten, die die Wirkung von CN und CS auf die Haut von Mensch und Tier
untersuchen. Holland und White (25) vergleichen CN
und CS. Beide Substanzen wurden sowohl trocken als auch mit Kochsalz angefeuchtet
auf die Haut aufgetragen und mit Hilfe eines Verbandes (Okklusivverband)
fixiert. Nach einer Stunde wurde der Verband entfernt und die Haut gewaschen.
Als Resultat konnte festgehalten werden, dass CN stärker reizt als
CS und dass beide Gifte, wenn feucht aufgetragen, heftigere Reaktionen
auslösen.
Auf CS reagierte die Haut in Form einer Reizung und vorabergehenden Rötung,
auf CN mit den gleichen Symptomen, zusätzlich aber mit Blasenbildungen
und zum Teil mit Hautpigmentveränderungen (postläsionäre
Pigmentverschiebungen). Die Autoren stellen fest, dass beide Gifte, CN
mehr als CS, eine Gefahr für die Haut darstellten, jedoch nur unter
Umständen, die weit entfernt von den üblichen "antiriot" Bedingungen
seien.
| Therapievorschläge:
|
 |
Akutes Zustandsbild
mit Rötung und Nässen: Umschläge mit Na Cl-Lösung
(1 Esslöffel Kochsalz auf 1 Liter Wasser). Mit Rötung, Brennen:
Hexacorton Creme. Bei starkem Juckreiz: Antihistaminika (Ambodryl Kaps.,
Fenistil Drag.)

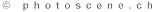
6.
Schadwirkungen auf die inneren Organe
Neben der Wirkung auf die exponierten Stellen der Körperoberfläche
(s.o.) darf bei der Tränengaswirkung aber die Schädigung der
inneren Organe nicht unberücksichtigt bleiben.
Diese Wirkung betrifft primär die "Eintrittspforten" des Tränengases,
die Schleimhäute der Atem- sowie der Verdauungswege. Auf diesem Wege
wird ein wechselnd grosser Teil des Giftes vom Körper aufgenommen
und entfaltet damit eine systemische Wirkung. Diese wiederum manifestiert
sich primär im "Transportsystem" der aufgenommenen Substanz, dem
Kreislaufsystem. Weiter ist eine Schädigung dort zu erwarten, wo
das Gift abgebaut und ausgeschieden werden muss, in der Leber und in der
Niere.
Fettlösliche Substanzen haben eine hohe Affinität auf das Zentralnervensystem,
beim fettlöslichen Tränengas ist also mit Auswirkungen auf das
Gehirn zu rechnen.
Neben der systemischen Wirkung der aufgenommenen Substanz ist häufig
auch mit einer toxischen Wirkung von Abbauprodukten zu rechnen, welche
gelegentlich gefährlicher sein können als die Substanz selber
(sog. Giftung). Unter den Abbauprodukten vom Tränengas finden sich
Cyanide, welche zu den giftigsten bekannten Substanzen gehören. Die
festgestellten Cyanid-Konzentrationen waren allerdings nie im gefährlichen
Bereich, die Cyanid-Entstehung ist also offenbar so langsam, dass das
anfallende Cyanid fortlaufend in das ungiftige Cyanat umgewandelt und
damit ausgeschieden werden kann.
Bei freiwilligen Versuchspersonen waren die Thiocyanatkonzentrationen
im Urin immer erhöht, ohne dass Zeichen einer Cyanid-Vergiftung festgestellt
worden wären. Bei akuten Todesfällen wurde allerdings die Cyanid-Konzentration
nie gemessen sodass diese Wirkung im Extremfall unbekannt ist.
| a) Luftwege und
Lungen |
 |
CN und CS führen
zu einer unterschiedlich intensiven Reizung der Atemwege, wahrscheinlich
reflektorisch damit zu einer raschen und flachen Atmung.
Bei geringer Exposition findet sich eine vermehrte Sekretion der Schleimhaut
der Atemwege, längere Exposition und höhere Konzentrationen
führen zu entzündlichen Veränderungen, im Extremfall zu
Schleimhautulcerationen (Geschwürsbildung).
Gelangt das Tränengas bei anhaltender Exposition (mangelnde Fluchtmöglichkeit,
geschlossener Raum) oder bei vertiefter Atmung (auf der Flucht, beim Rennen)
bis in die Lungenbläschen (Alveolen), so kann das Alveolarepithel
geschädigt werden. Es kommt entweder zu Blutungen in die Lungenbläschen
oder zum Uebertritt von Blutflüssigkeit in die Alveolen, zum Lungenoedem
(28). Die betroffenen Lungenabschnitte sind auf jeden
Fall nicht mehr funktionstüchtig. Ohne sofortige Behandlung kann
diese Komplikation tödlich sein. Ein solches Lunqenoedem stand auch
im Vordergrund (neben den meisten hier beschriebenen Schädigungen)
beim Tränengasunfall in Uster, der durch sein gerichtliches Nachspiel
eine gewisse Publizität erlangt hat (s. Einleitung).
Bekannt wurde auch der Fall eines 4 Monate alten Kleinkindes, welches
nach Tränengasexposition tagelang maschinell beatmet werden musste.
Neben den entzündlichen Veränderungen spielte bei diesem Kind
die massive Schleimsekretion in den Atemwegen eine Rolle, welche zu einem
Verschluss der kleinen Atemwege führte. Es kam damit zu einem Funktionsausfall
der nachgeschalteten Lungenabschnitte.
Wichtig beim Lungenoedem ist, dass es noch nach einer Latenz von 1-2 Tagen
nach der Exposition auftreten kann. Zeigt also ein Exponierter bei der
ärztlichen Erstkonsultation noch keine pulmonalen Symptome, so ist
auch bei ordentlichem Befinden mit deren Auftreten noch während der
folgenden 48 Stunden zu rechnen. Jeder massiv Tränengasexponierte
müsste damit eigentlich 2 Tage hospitalisiert werden.
Die Gefährdung des Lungengesunden ist im wesentlichen überschaubar
und kalkulierbar. Ist eine rasche Flucht möglich, so ist im allgemeinen
mit einer ernsten Schädigung der Luftwege und der Lungen nicht zu
rechnen. Anders allerdings bei vorbestehenden Lungenleiden, so bei der
sehr häufigen chronischen Bronchitis sowie beim Asthma. Schon geringe
Exposition kann bei chronischer Bronchitis oder beim Asthmatiker zu akuten
Todesfällen führen.
| b) Verdauungstrakt
|
 |
Jede Substanz, die
über Mund und Nase zu den Lungen gelangt, wird, wie zum Beispiel
auch Zigarettenrauch, in einem wechselnden Ausmass auch verschluckt. Die
Giftwirkung auf die verdauenden Schleimhäute ist mit derjenigen des
respiratorischen Epithels (Luftwege) vergleichbar. Es kommt zu entzündlichen
Veränderungen, bei grosser Giftmenge auch zu Geschwürsbildung
(Ulcerationen). Bei Versuchstieren wurden ausserdem schwere Bauchfellentzündungen
(peritonitische Reaktionen) beobachtet, in seltenen Fällen auch Bauchhöhlenabzesse
(peritoneale Abszesse). Im Falle eines Ueberlebens sind multiple Verwachsungen
im Bauchraum die Folge dieser Bauchfellreizungen.
| c) Blut und Kreislauf |
 |
Eine Schädigung
des Blutes oder der blutbildenden Systeme wurde bisher nicht beobachtet.
Anders bezüglich des Kreislaufsystems. Es kommt zu einem akuten Blutdruckanstieg
sowie zu einer Zunahme der Herzfrequenz. Wie diese Wirkung vermittelt
wird, ist unklar, ob durch die aufgenommene Substanz oder deren Metaboliten
(Abbauprodukte) oder möglicherweise als Angstreaktion, die sogenannte
Sympathicotonie.
| d) Leber und
Niere |
 |
Die meisten Fremdsubstanzen,
welche in den Körper gelangen, werden in der Leber metabolisiert,
d.h. chemisch umgewandelt und damit ausscheidungsfähig gemacht. Ausscheidungsfähig
heisst meist nierengängig, nur ein kleiner Teil von Fremdsubstanzen
wird durch die Galle ausgeschieden.
Bei den meisten Giften sind diese beiden Organsysteme damit am meisten
exponiert und gefährdet, da sich in ihnen die höchsten Konzentrationen
der Gifte finden.
Die bei massiver Exposition im Tierversuch gefundenen Schäden sind
zentriloboläre Nekrosen (Untergang von Lebergewebe). Auch bei nur
kurzer Exposition wurden Vorstufen dieser Leberzellnekrosen, zentrilobuläre
grob und feintropfige Leberzellverfettung, gefunden. Diese Wirkung ist
unspezifisch, sie gleicht derjenigen der meisten lebertoxischen Substanzen
(30).
Die an der Niere beobachteten Schäden sind vergleichbar, es sind
tubuläre Nekrosen, also Schleimhautnekrosen der feinen Harnkanälchen
in der Niere (30). Ob diese Wirkung ein direkter Effekt
der Substanz oder deren Metaboliten ist, die sich in diesen Kanälchen
ansammeln, oder ob es sich um eine indirekte Wirkung - Hypoxämie
aufgrund der Lungenschädigung - handelt, ist nicht entschieden.
| e) Zentralnervensystem |
 |
Diese Wirkung ist
von Individuum zu Individuum verschieden. Es kann zu einem Stupor und
damit zu einer Handlungs- und Bewegungsunfähigkeit mit völlig
inadäquaten Reaktionen kommen. Die Nachwirkung dieser zentralen Effekte
sind gelegentlich längere, leichte Trübungen des Bewusstseins,
gelegentlich auch anhaltende Kopfschmerzen (31/32).
f) Zusammenfassung
Tränengase schädigen die Schleimhäute der Atemwege und
des Magen-Darm-Kanals. Höhere Konzentrationen können zu schweren
Entzündungen oder sogar zu Geschwürsbildungen führen, bei
Inhalation also zu einer schweren Bronchitis, bei zusätzlichem Verschlucken
zu einer Entzündung des Magen-Darm-Kanals.
In geschlossenen Räumen oder bei Mangel an Fluchtmöglichkeiten
gelangt das Tränengas in die Lungenbläschen, es kommt zum toxischen
Lungenoedem, zum Uebertritt von Blutflüssigkeit in die Lungen (und
damit zum Funktionsverlust der Lungen).
Durch Tränengase können auch Leber und Niere geschädigt
werden. Diese Organe können durch das Gift eines Teils ihres Gewebes
verlustig gehen.
Da Tränengase fettlösliche Substanzen sind, haben sie auch eine
ausgeprägte Wirkung auf das Gehirn. Diese Wirkung ist je nach Individuum
verschieden: entweder völlige Aktionsunfähigkeit oder aber Panikstimmung
mit der Tendenz, völlig sinnlose wirre Sachen zu machen.
| Behandlung: |
 |
Eine einfache Schleimhautreizung
mit vorübergehendem Husten braucht nicht behandelt zu werden. Ist
die Schleimhautreizung intensiver, sodass zusätzlich Schmerzen in
der Brust und evtl. auch Blutspucken dazukommt, ist ärztliche Hilfe
notwendig. Tritt ausserdem noch Atemnot auf, so besteht die Gefahr eines
Lungenoedems. Eine Hospitalisation ist dann unerlässlich Die Leber
und Nierenschäden, sofern sie bei den auftretenden Konzentrationen
überhaupt zu befürchten sind, sind nicht behandlungsbedürftig,
da mit einer ins Gewicht fallenden Funktionseinbusse des betroffenen Organs
nicht zu rechnen ist.
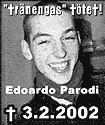 Todesfälle
als Folge von Tränengasexposition sind bekannt. Einige wurden ausführlich
untersucht und beschrieben. Todesfälle
als Folge von Tränengasexposition sind bekannt. Einige wurden ausführlich
untersucht und beschrieben.
1960 berichtete W. Naeve (33) vom
gerichtsärztlichen Dienst Hamburg über eine tödlich verlaufene
CN-Vergiftung eines 24-jährigen flüchtenden Mannes, der von
der Polizei in einem Kellerraum mit CN Wurfkörpern eingeräuchert
wurde. Nach etwa 20 Minuten wurde er bewusstlos aufgefunden, 1 Stunde
später stellte man in der Klinik das Bild eines schweren, therapeutisch
nicht beeinflussbaren Lungenoedems mit Kreislaufversagen fest. Er starb
7 1/2 Stunden nach der Tränengaseinwirkung. Der pathologisch-anatomische
Befund bot uncharakteristische Veränderungen, die denen entsprechen
wie sie bei anderen tödlich verlaufenen Vergiftungen mit lungenreizenden
Gasen anzutreffen sind, nämlich "eine akute leucocytäre Bronchitis
und Bronchiolitis, die durch Verlegung der Bronchiallichtungen mit Exsudat
zu akutem vesiculärem Lungenemphysem und zu hochgradiger Hyperämie
mit akutem Lungenoedem geführt hat".
1964 publizierten A. Stein und W. Kirwan (34)
einen Todesfall nach CN-Exposition zusammen mit Angaben über 3 weitere
Todesfälle, die ihnen bei einer Umfrage an anderen amerikanischen
Pathologie-Instituten mitgeteilt wurden. Der 29jährige Mann, angeblich
mit psychiatrischer Vorgeschichte, der sich im Zusammenhang mit seinem
Kampf gegen das Abreissen seines Hauses, das einer Autobahn hätte
weichen müssen, tätlich gegen eine polizeiliche Untersuchung
wehrte, wurde in einem kaum belüfteten Raum (700 cubic feet) mit
einer CN-Granate (128 g) beschossen, wo er ca. 30 Minuten eingeschlossen
blieb (nach den Berechnungen der Autoren ergibt dies ein vielfaches der
tödlichen Konzentration). Er wurde in einem agitierten semicomatösen
Zustand hospitalisiert, er zeigte enge nicht reagierende Pupillen und
reichlichen mucösen Ausfluss aus Nase und Mund. Nach 12 Stunden entwickelte
sich plötzlich ein Lungenoedem, an dem er starb. Die wichtigsten
postmortalen Befunde waren pathologische Veränderungen der Lungen
(Lungenoedem, intraalveoläre Hämorrhagien, Schleimhautnekrose
mit fibrinreichen Pseudomembranen), aber auch von Leber und Hirn. Bei
den anderen 3 Fällen fielen auch die neurologischen Symptome bei
der Hospitalisierung auf, die Latenzzeit zwischen Hospitalisierung und
Tod war 8 1/2 Stunden bis 4 Tage, alle zeigten ähnliche postmortale
Lungenbefunde. Stein und Kirwan kommen zu einer ähnlichen Einschätzung
der Giftwirkung von CN wie Naeve: "In giftigen Dosen ist es ein starkes
Reizmittel für das gesamte Atmungssystem und die chemische Verletzung
erleichtert schliesslich die Entwicklung eines Lungenoedems mit Todesfolge.
Andere Untersuchungen zeigen, dass es in hohen Konzentrationen Hautverbrennungen
1. und 2. Grades produziert. Im weiteren entstehen sekundäre Komplikationen,
möglicherweise wegen der Adsorption der Noxe oder in Zusammenhang
mit der begleitenden Anoxie."
Der letzte Todesbericht ist datiert 1978. Chapman (35)
beschreibt einen Todesfall nach Tränengaseinsatz (CN und CS) zur
Bekämpfung einer Gefängnisrevolte ("a disturbance") im Hochsicherheitstrakt
des Oklahoma State Penitenciary in McAlester, wobei die Insassen während
etwa 2 Stunden in ihren Einzelzellen, deren Ventilationssystem abgestellt
wurde, begast wurden. Der 33jährige Mann wurde nach 46 Stunden in
seiner Zelle tot aufgefunden. Es wurde ärztlich nicht untersucht,
obwohl er mehrmals nach Angabe anderer Insassen danach gefragt hatte.
Die Autopsie ergab als Todesursache eine akute nekrotisierende Laryngotracheobronchitis
mit Pseudomembranenbildung; um verlegte Bronchiolen herum fanden sich
bronchopneumonische Herde, Oedem und nur wenig intraalveoläre Blutungen
waren vorhanden. Ein Gericht entschied unter Zuziehen eines anderen Arztes,
dass dieser Tod nichts mit Gas zu tun hatte. Das erschreckende an diesem
Fall ist, dass trotz wachsendem klinischem Wissen Über die Giftwirkung
von Tränengasen diese weiterhin ohne Berücksichtigung der unterdessen
bekannten Gebrauchsanweisungen eingesetzt werden.
Alle Opfer waren bisher jung und gesund. Dies ist ein bitterer Beweis
für die Gefährlichkeit der Tränengase. Wären die Opfer
gesundheitlich vorgeschädigt, würde man zweifeln, ob diese nicht
an ihrem Grundleiden oder an Altersschwäche gestorben wären.
So starb 1968 in Paris anlässlich eines CN-Einsatzes
während einer Demonstration ein alter Mann, der Asthmatiker war und
dessen Parterrewohnung sich in der Nähe befand. Die NZZ (13./14.8.1977)
kommentiert diesen Todesfall wie folgt: "Ob er wirklich an einer CN-Vergiftung
starb scheint fraglich, da das Opfer ein starker Asthmatiker war." In
unaberschaubaren Situationen ist es schwierig, die genauen Todesursachen
zu eruieren. Nach dem Tränengaseinsatz während eines Fussballmatches
in Lima (Peru), vom 24.5.64 brach eine Panik aus, 312 Peruaner blieben
tot im Stadion zurück. In einer solchen Situation ist es schwierig,
beweiskräftig das Tränengas als Todesursache zu ermitteln.
Darum muss festgehalten werden, und die obigen Beispiele beweisen dies,
dass junge und gesunde Menschen nach einem Tränengaseinsatz sterben
können, wobei der Tod als Folge einer Lungenerkrankung (Lungenoedem)
eintritt.
|
PigBrother
März 2002
Tod durch "Tränengas"
Ein internationaler Überblick
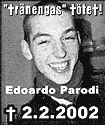 Wie
der Tod von Edoardo Parodi einmal mehr
zeigt, tun sich Behörden und offizielle Organe aus naheliegenden
Gründen schwer mit der Dokumentation von Todesfällen,
bestreiten diese glattwegs und stellen fadenscheinige Schutzbehauptungen
auf (1, 2). Berichte
von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen sowie der VUA-Report
belegen jedoch, dass der «harmlose Reizkampfstoff» unter
Berücksichtigung der bestimmt nicht unbeträchtlichen Dunkelziffer
weltweit bisher weit über 1000 Todesopfer gefordert
hat: Wie
der Tod von Edoardo Parodi einmal mehr
zeigt, tun sich Behörden und offizielle Organe aus naheliegenden
Gründen schwer mit der Dokumentation von Todesfällen,
bestreiten diese glattwegs und stellen fadenscheinige Schutzbehauptungen
auf (1, 2). Berichte
von Menschen- und Bürgerrechtsorganisationen sowie der VUA-Report
belegen jedoch, dass der «harmlose Reizkampfstoff» unter
Berücksichtigung der bestimmt nicht unbeträchtlichen Dunkelziffer
weltweit bisher weit über 1000 Todesopfer gefordert
hat:
>>>
1960 ereignete sich ein Todesfall in Hamburg BRD (4).
>>> Aus den USA sind von ca. 1960-1978 mindestens
5 Todesfälle bekannt (5, 6).
Laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts kam es in den USA ausserdem
durch CN zu mindestens 100 Augenverlusten (vgl. CILIP
Nr. 9/10, S. 183-196, 1981).
>>> Laut dem Bertrand Russel Tribunal forderte der
Einsatz von CN und CS durch die amerikanische Armee im Vietnamkrieg
1964-1975 gegen Dörfer und Tunnelsysteme mindestens
689 Todesopfer (nadir).
Da der Einsatz von Giftgasen im Kriegsfall völkerrechtlich
geächtet ist, ratifizierten die USA das entsprechende Genfer
Protokoll aus dem Jahre 1925 erst 1975 am Ende des Vietnamkrieges
(3).
>>> Erst mit 9 Jahren Verspätung in der Schweiz
publik wurde ein Todesfall aus dem Jahr 1968 in Frankreich
(1).
>>> Vereinzelte Todesfälle durch "Tränengas"
wurden auch aus Irland gemeldet (nadir).
>>> Anfang 70er starb 1 Polizist bei Brokdorf
an "Tränengas". Trotz anderslautenden ärztlichen
Aussagen stritt die Regierung sämtliche Verantwortung ab. Danach
wurde das Gas lange Zeit zumindest in Norden der BRD nicht mehr
eingesetzt. (indymedia)
>>> Ein Todesfall durch "Tränengas" von
einem Kleinkind wurde gemeldet aus Duncan Village, Südafrika,
August 1985 (struth.org.za)
>>> 1986 kam es in der BRD am Ostermontag
bei der CS-Premiere zu einem weiteren Todesfall unweit des
Bauzauns der WAA Wackersdorf. "Wer CS einsetzt, nimmt den Tod in
Kauf " titelte der «Spiegel» darauf und führte
weitere Gesundheitsschäden an: "beginnendes Lungenödem
und Atemschock", "Brustschmerzen und Atembeschwerden" (S. 45), "fünfmarkstückgrosse
Blasen mit Wasser", eine "deutlich erhöhte Blutungsneigung"
und einen "ganz schweren Halsabszess" (S. 46). (vgl. nadir)
>>> Laut Amnesty International starben in Palästina
allein Dezember 1987-1990 ca. 80 Menschen (amnesty).
An einem weiteren Bericht aus dem Jahre 1990 beteiligte Forscher
haben eine Stichprobe von 3.299 Unterlagen über "Tränengas"-Verletzungen
angefertigt und schätzen, dass während der beiden untersuchten
Jahre 1987-1989 10.600 bis 13.200 Kinder sich einer medizinischen
Behandlung unterziehen mussten aufgrund von Verletzungen, die auf
Einwirkung von "Tränengas" zurückzuführen
sind (TU-Berlin).
>>> In Bahrain kamen nach Meldungen von Amnesty
International im Januar und Februar 1995 durch "Tränengas"
2 Menschen ums Leben (amnesty).
>> In Bolivien starb 1997 Freddy Rojas, ein
22 Monate alter Junge, an den Folgen von Vergiftungen, nachdem er
"Tränengas" eingeatmet hatte (amnesty).
>>> Im Februar 1997 starb in Ecuador ein
18jähriger an "Tränengas" (zoom).
>>>
Laut einem 2000 veröffentlichten Bericht starb zwischen 1995
und 1999 in Sarawak ein Penan-Ureinwohner während der
Auseinandersetzungen um die Abholzung des Regenwaldes an "Tränengas"
(Bruno
Manser Fonds).
>>> Zu 20 Todesfällen durch CS kam es 1999
in der Türkei bei einem Einsatz der türkischen
Armee gegen Kurden (Kurdischer
Roter Halbmond).
>>> Am 28. April 1999 starb in Nigeria der
Journalist John Musa durch einen "Tränengas"-Einsatz
der Polizei (IPI
Death Watch).
>>> Gemäss vereinzelten Meldungen starben in Palästina
November 2000-2001 erneut mindestens 5 Menschen an
"Tränengas" (LAW,
Abendblatt,
Deutsches
auswärtiges Amt [Seite inzwischen
entfernt – warum wohl?], arabia.com).
Es liegen weitere Meldungen vor mit unbestimmter Opferangabe («many»)
(LAW)
und viele Berichte stehen noch aus, so dass die Zahl bekanntgewordener
Opfer sicher noch steigt.
>>> Laut einem Bericht der italienischen Zeitung «La
Repubblica» vom 21.2.02 starb 2000 ein junger Schweizer
mit einschlägigen Symptomen, nachdem er an einer Kundgebung
teilgenommen hatte und dabei "Tränengas" eingeatmet
und von der Polizei mit einer «mysteriösen brennenden
Flüssigkeit» [= CN-Wasser-Gemisch]
abgeduscht worden war.
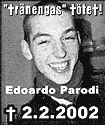 |
>>>
Am 3.2.02 stirbt in Lugano (Schweiz) Edoardo Parodi
ca. 30 Stunden, nachdem er an einer Demonstration in Zürich
erhebliche Mengen "Tränengas" eingeatmet hat,
mit allen typischen Symptomen. Die Behörden wollen von einem
Zusammenhang nichts wissen und setzen Falschmeldungen in
Umlauf, sämtliche Schweizer Medien verschweigen den
Fall. >>> ausführlicher
Report
>>> Ende Februar 2002 sind in Ecuador
nach Berichten der Zeitung "La Hora" 2 Kinder an "Tränengas"
erstickt (indymedia).
Zusätzlich kam es in 11 Fällen zu Atemnot bzw. Stillstand,
eine Person wurde durch eine Gasgranate im Gesicht schwer verletzt
(indymedia).
Diese Liste basiert auf einer Web-Recherche und erhebt keinerlei
Anspruch auf Vollständigkeit. Wer Kenntnis von weiteren Fällen
hat melde diese bitte mit genauer Quellenangabe an
pigbrother@ssi-media.com
|

Vorne
links: Beamter mit umgebautem Flammenwerfer
40
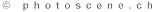
| 8. Tränengase
im Völkerrecht |
 |
Der folgende Exkurs
über die völkerrechtlichen Aspekte des Einsatzes von chemischen
Waffen ist rudimentär. Die Beschaffung der notwendigen Dokumente
gestaltete sich schwieriger, als wir angenommen hatten. Da wir unseren
medizinischen Bericht rasch veröffentlichen wollten, sind wir bei
diesem Kapitel unter Zeitdruck geraten. Das wenige Material, das wir finden
konnten, wollen wir dennoch publizieren mit dem Vorbehalt, dass Fehler
vorhanden sein können. Wir möchten hoffen, dass demnächst
kompetente Völkerrechtler sich diesem Problemkreis annehmen.
Bereits 1874 fanden in Brüssel internationale Beratungen statt, die
sich mit den Gefahren der Verwendung von Giften und vergifteten Waffen
befassten . Die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 waren Folgekonferenzen
der Brüsseler Tagung. Bei den Beratungen nahmen die Fragen der Entwicklung
von chemischen Waffen einen breiten Raum ein. Wir zitieren einen wichtigen
Artikel der Haager Friedenskonferenz vom 18.10.1907:
Art.
23:
"Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten
ist namentlich untersagt:
a) die Verwendung von Giften oder vergifteten Waffen.
b) die Verwendung von Waffen, Geschossen und Stoffen, die geeignet
sind, unnötige Leiden zu verursachen.
c) die Verwendung von Geschossen, deren einziger Zweck ist, giftige
oder erstickende Gase zu verbreiten. Die Splitterwirkung muss immer
die Giftwirkung übertreffen." |
Die sogenannte "Haager Landkriegsordnung" wurde von nahezu allen
europäischen Staaten unterzeichnet. Diese Verträge wurden jedoch
rasch unterlaufen. Tränengase waren vor und während dem ersten
Weltkrieg bedeutende Teile der Kriegsarsenale.
1919 wurde den Verlierern des ersten Weltkriegs, in erster Linie Deutschland,
der Versailler Vertrag aufgezwungen. Darin wird Deutschland Oesterreich,
Ungarn, Bulgarien und der Türkei die Herstellung, Entwicklung und
Einführung chemischer Waffen verboten.
Anfangs der zwanziger Jahre fanden diverse Abrüstungskonferenzen
statt, es wurde ein allgemeines Verbot chemischer und bakteriologischer
Waffen vorbereitet. An der Washingtoner Konferenz 1921 billigten sogar
die USA vorerst einen Verbotsaufruf. Insgeheim betrieben aber die USA,
Frankreich und Grossbritannien weiterhin militärchemische Forschungen
. Und der deutsche Grosskonzern IG Farben bedauerte, dass gemäss
Versailler Vertrag "das deutsche Heer in künftigen Kriegen sich keiner
Waffe bedienen darf, die humaner als die sonst gebrauchten Mittel ist."
Das
für uns wichtige Abkommen ist das
Genfer Protokoll vom 17.6.1925
Im folgenden drucken wir den Inhalt dieses Protokolls ab. (Quelle:
Europa Archiv Nr. 22/1969) |
 |
In
der Erwägung daß die Verwendung von erstickenden, giftigen
oder gleichartigen Gasen sowie allen ähnlichen Flüssigkeiten
Stoffen oder Verfahrensarten im Kriege mit Recht in der allgemeinen
Meinung der zivilisierten Welt verurteilt worden ist.
In der Erwägung, daß das Verbot dieser Verwendung in den
Verträgen ausgesprochen worden ist, an denen die meisten Mächte
der Welt beteiligt sind.
In der Absicht eine allgemeine Anerkennung dieses Verbots, das in
gleicher Weise eine Auflage für das Gewissen wie für das
Handeln der Völker bildet, als eines Bestandteils des internationalen
Rechts zu erreichen - erklären die unterzeichneten Bevollmächtigten
im Namen ihrer Regierungen.
Die Hohen vertragsschließenden Parteien anerkennen soweit sie
nicht schon Verträge geschlossen haben, die diese Verwendung
untersagen, dieses Verbot an. Sie sind damit einverstanden, dass dieses
Verbot, auch auf die bakteriologischen Kriegsmittel ausgedehnt wird
und kommen überein, sich untereinander an die Bestimmungen dieser
Erklärung gebunden zu betrachten. Die Hohen Vertragschließenden
Parteien werden sich nach besten Kräften bemühen, die anderen
Staaten zum Beitritt zu dem vorliegenden Protokoll zu veranlassen.
Dieser Beitritt wird der Regierung der Französischen Republik
und sodann durch diese allen Signatar- und beitretenden Mächten
angezeigt werden. Er erlangt mit dem Tage Wirksamkeit, an dem er durch
die Regierung der Französischen Republik angezeigt wird. Das
vorliegende Protokoll, dessen französischer und englischer Text
maßgebend sind, soll sobald wie möglich ratifiziert werden.
Es trägt das Datum des heutigen Tages. Die Ratifikationsurkunden
des vorliegenden Protokolls werden der Regierung der Französischen
Republik übermittelt, diese teilt die Hinterlegung jeder der
Signatar- oder beitretenden Mächte mit: Die Ratifikations- oder
Beitrittsurkunden bleiben in den Archiven der Regierung der Französischen
Republik hinterlegt. Das vorliegende Protokoll tritt für jede
Signatarmacht mit dem Tage der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde
in Kraft; von diesem Zeitpunkt an ist diese Macht gegenüber den
anderen Mächten, die bereits Ratifikationsurkunden hinterlegt
haben, gebunden. Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten
das vorliegende Protokoll unterzeichnet. Geschehen zu Genf in einer
einzigen Ausfertigung am 17. Juni 1925.
|
In diesem Abkommen
wird der chemische und bakteriologische Krieg verurteilt und verboten.
Viele Staaten unterschrieben dieses Protokoll, so auch die USA, ratifizierten
den Vertrag aber nicht.
Eine UN-Resolution während der 24. UN-Vollversammlung 1969 forderte
alle Staaten auf, das Genfer Protokoll zu ratifizieren, falls sie dies
noch nicht gemacht hätten. Diese Resolution erklärt, dass "die
chemischen und biologischen Methoden der Kriegsführung immer mit
Schrecken betrachtet werden und nach Recht der internationalen Gemeinschaft
verurteilt worden sind" und "dass sich die Anwendung dieser Methoden
ohne Rücksicht auf ihren technischen Entwicklungsstand in bewaffneten
Konflikten verbietet." In einem Bericht vom damaligen Generalsekretär
der UNO, U. Thant, forderte dieser alle Staaten auf, eine Versicherung
abzugeben, dass dieses Verbot für alle chemischen, bakteriologischen
Kampfmittel, einschliesslich Tränengasen und anderen Reizgasen gilt.
Dieser Aufforderung folgten über 20 Staaten. Die
USA ratifizierten diesen Vertrag erst 1975, am Ende des Vietnamkrieges.
Die USA setzten im Vietnamkrieg vor 1966 hauptsächlich CN und Adamsit,
später das wirksamere CS ein. 1969 benötigten die USA noch 3000
Tonnen CS gegen das vietnamesische Volk. Soviel wir wissen, wurde das
Genfer Protokoll von der Schweiz unterschrieben. Was die obenerwähnte
Resolution betrifft, sprachen sich die USA gegen die Einbeziehung von
Tränengasen und Entlaubungsmitteln in dieser Resolution aus und stimmten
nicht zu. Ebenso enthielten sich die NATO-Staaten, Israel und Südafrika
der Stimme. Nach dem, was wir recherchieren konnten, haben die meisten
Staaten der Welt das Genfer Abkommen ratifiziert. Was die Resolution von
1969 der UNO betrifft, welche unter anderem auch Tränengase hätte
verbieten sollen, haben offenbar einige Staaten Vorbehalte angemeldet.
Anzumerken ist dabei, dass diese Abkommen für kriegerische Auseinandersetzungen
gelten, und dies, obwohl in der Militärgeschichte bekannt ist, dass
in kriegerischen Auseinandersetzungen die Zivilbevölkerung immer
mehr in Mitleidenschaft gezogen wird.
Zum Abschluss möchten wir im Zusammenhang dieser Problematik noch
unseren Polizeivorstand Frick sprechen lassen (Antwort auf eine Interpellation
im Gemeinderat von Gemeinderat Mascetti): "Im übrigen sind die sogenannten
Genfer Konventionen völkerrechtliche Abkommen, die im Kriege zwischen
Staaten Anwendung finden. Gewisse Bestimmungen dieser Abkommen haben zwar
auch im Falle von Bürgerkriegen Gültigkeit; Ordnungsdienst-Einsätze
der Polizei fallen nicht darunter." Ein Kommentar erübrigt sich.

Zürcher Stapo
1968 mit umgebauten Flammenwerfern
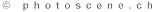
9.
Stellungnahme der Arbeitsgruppe "Tränengas" der Vereinigung unabhängiger
Aerzte der Region Zürich
Die von der Zürcher Polizei eingesetzten Kampfmittel, die Tränengase
CN und CS sind gefährlich. Die medizinischen Schäden, die sie
anrichten können, sind beträchtlich: Hautschäden (Verbrennungen,
Allergisierungen), Augenschäden (Entzündungen, Verlust der Sehkraft),
Lungenschäden (Lungenoedem). Tränengas kann ebenso tödliche
Auswirkungen haben.
Die Polizei hat bewiesen, dass sie die Vorsichtsmassnahmen, die die schädigenden
Auswirkungen dieser Mittel in Schranken halten könnten, nicht einhalten
kann. Wir wissen, dass mehrmals Tränengas in geschlossene Arrestantenfahrzeuge
gesprayt wurde. Auf Todesopfer durch Tränengaseinsätze wollen
wir nicht warten. Wir fordern die verantwortlichen Politiker und Polizeiorgane
auf, die Tränengaseinsätze einzustellen. Wir meinen, dass das
gleiche auch für die Gummigeschosse gilt, die wir in dieser Arbeit
nicht berücksichtigt haben. Wir wissen ebenso, dass wir bis heute
2 schwere Augenverletzungen in Zürich durch Gummigeschosse zu beklagen
haben.
Wir fordern die Politiker auf, die Polizisten von dieser gefährlichen
Arbeitsausrüstung zu entlasten.
| 10. Quellen |
 |
1) Institut für Toxikologie, ETH und Universität Zürich,
4.7.80
2) Ballantyne, Gall, Robson: Med. Sci. Law, 1976, Vol
16, No 3, p 159
3) Ballantyne, Beswick, Price Thomas: Med. Sci. Law 13,
265-268, 1973
4) Beswick, Holland, Kemp: Brit. J. industr. Med: 1972,
29, 298-300
5) Schrempf Alfred: Chemie in unserer Zeit, 12. Jahrg,
1978, S. 146-152
6) Sanford J: Riot Control Agents, 1976, p 421-429
7) Franke S: Militärchemie, Band 1 Berlin DDR 1977
8) NZZ Nr. 188, 13./14. August 1977, S. 35
9) Guillaumat, Chatellier, Bull. Soc. Ophthal. Fr. 69,
548 (1969)
10) Levine, Stahl, Amer. J. Ophthal. 65, 497 (1968)
11) Doden W. et. al. Klin. Mtbl 155, 855 (1969)
12) Ballantyne et al. Arch. Toxicol. 32, 149-168 (1974)
13) Ballantyne et al. Arch Toxicol. 34, 183-201 (1975)
14) Oksala A. et al. Acta Ophthalmol. 53, 908-913 (1975)
15) Chemical Police escort Tränengasspray Firma
IMUWA Int. Prospekt. Postfach Nr. 1705, 3001 Bern
16) Rose. L. Ophthalmologica Addit ad 158, 448-454 (1969)
17) Hoffmann D. H. Brit. J. Ophthal. 51(4), 265-68 (1967)
18) Ballantyne, B. and Swanston, D. W., Arch. Toxicol. 40, 75-95 (1978)
19) Dietel, F., Med. Klin. 29, 1208 (1933) Frazier, C.A., JAMA 236, 2526
(1976)
20) Frazier, C. A. , JAMA 236, 2526 (1976)
21) Holland,
P. and White, R.G., Br. J. Dermatol. 86, 150-154 (1972)
22) Ingram, J. T., Br. J. Dermatol. 54, 319-321 (1942)
23) Kissin, M. and Mazer, M. The Bulletin of the U.S.
Army Medical Department, 81, 120-121 (1944)
24) Madden, J. F. and Paul, ST., Arch. Dermatol. Syphil.
63, 133-134 (1951)
25) Queen, F.B. and Stander, T. JAMA 117, 1879 (1941)
26) Schwartz, L. and Tulipan, L., Occupational Diseases
of the Skin, 237. London, H. Kimpton (1939)
27) Vedder, F.B., Medical aspects of chemical Warfare.
Baltimore: Williams and Wilkins, 171 (1925)
28) Ballantyne B., Toxicology 8 (1977), 347 ff
29) Sungmin Park et al., Amer. J. Ois. Child 123, 1972,
245 ff
30) Ballantyne B. et al. Arch. Toxicol. 40, (1978),
75 ff
31) TA 22.10.1980
32) Auskunft des Tox Zentrums
33) Naeve W., Arch. für Toxicol., 18, 165-169, 1960
34) Stein A.A., Kirwan W.E.: J of Forensic Sci, 9, 374-382,
1974 White Ch: J of 23 (3), 527-530
35) Chapman A.J. Forensic Sci, 1978
|
Quelle: GASREPORT.
Aus: AG Doku Autonome Sanitätsgruppe, Gruppe Gas der Vereinigung
unabhängiger Ärzte der Region Zürich: TRÄNENGAS,
SELBSTHILFE, PATIENTENRECHTE, AUTONOME SANITÄT. Verlag Citron
Presse, Zürich, S. 71-92. ISBN 3-85611-000-3 (vergriffen)
|
| 11.
Links |
 |
Weitere
Infos:
GUMMIGESCHOSSE,
WASSERWERFER, CS - Schnellabschaltung
der Bürgerrechte: Die neuen Waffen der Polizei. Broschüre
1986 online bei nadir.org
Kontaktallergien
durch die Reizstoffe CN und CS. Dissertation 1989 (Fachbereich
Medizin, Universität Göttingen) Teilabdruck online bei nadir.org
inkl. ZIP-download
Erste
Hilfe gegen "Tränengas" aus der Broschüre
"RUHIG BLUT! Selbstschutz und Erste Hilfe bei Demonstrationen und
Aktionen" bei nadir.org
--> Ruhig
Blut! Selbstschutz
und Erste Hilfe bei Demonstrationen und Aktionen | Ihnaltsverzeichnis
Erste Hilfe gegen Pfefferspray bei Demosaniteter.de
|
